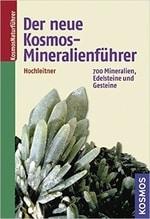Chrysoberyll
Chrysoberyll - Eigenschaften, Entstehung und Verwendung
englisch: chrysoberyl | französisch: chrysobéryl
Chrysoberyll = Goldberyll
Der Name Chrysoberyll findet erstmals als Krisoberil im Jahr 1789 Erwähnung, als im Bergmännischen Journal von einem neuen Mineral berichtet wird, das man vorab für eine Varietät von Hyazinth hielt, aber aufgrund eingehender Untersuchungen den Status eines eigenständigen Minerals verlieh.
Der Name Chrysoberyll wiederum ist dem deutschen Mineralogen Abraham Gottlob Werner (1749 bis 1817) zu verdanken: Chrysoberyll wird aus dem Griechischen mit Goldberyll übersetzt – in Anspielung „seines goldfarbigens Glanzes“ (Georgius Agricola, deutscher Mineraloge und Geologe, 1494 bis 1555) und die Zusammensetzung bzw. die Gehalte an Beryllium.
Eigenschaften von Chrysoberyll
Chrysoberyll ist mit der chemischen Zusammensetzung BeAl2O4 ein Vertreter der Mineralklasse der Oxide und umfasst zudem die Varietäten Alexandrit und Katzenaugenchrysoberyll (Cymophan). Entgegen dem Namenszusatz Beryll ist Chrysoberyll keine Varietät von echtem Beryll.
Chrysoberyll kristallisiert dem orthorhombischen Kristallsystem folgend. Die Kristalle sind prismatisch oder tafelig, auch zu Zwillingen und Drillingen – teilweise sternförmig – miteinander verwachsen. Die Aggregate des Minerals sind massig oder körnig.
Chrysoberyll zeichnet sich durch eine durchsichtige bis durchscheinende Transparenz bei glasartigem bis fettigen Glanz aus. Der Bruch des berylliumhaltigen Minerals ist muschelig bis uneben, die Spaltbarkeit ist vollkommen.
Mit einer Mohshärte von 8,5 auf der 10-stufigen Skala der Härte von Mineralien nach dem deutschen Mineralogen Friedrich Mohs (1773 bis 1839) ist Chrysoberyll ein sehr hartes Mineral, das in den Bereich der Edelsteinhärte (Mohshärte über 7) fällt und dessen Härte nur noch von Korund (Leukosaphir, Rubin und Saphir) sowie Diamant übertroffen wird. Die Dichte von Chrysoberyll beträgt 3,68 bis 3,8 g/cm³.
Die Farbe von Chrysoberyll
Trotz des Namens ist Chrysoberyll längst nicht nur von gold-gelber Farbe. Vielmehr bezieht sich der Name auf den goldartigen Unterton des Edelsteins. Die Mehrheit aller Chrysoberylle ist grün.
Der Mineraloge Gustav Rose (1798 bis 1873) schrieb 1842 im Rahmen seiner Russland-Expedition mit dem Naturgelehrten Alexander von Humboldt „Ueber den Chrysoberyll vom Ural“: die „Farbe ist grasgrün und dunkler als die des beibrechenden Smaragds“.
Der böhmische Naturwissenschaftler Franz Xaver Zippe (1791 bis 1863) führt die Grün-Nuancen 1859 genauer aus: „grünlichweiss, olivengrün, grünlichgrau, grasgrün, smaragdgrün“.
Der Chemiker Johann Friedrich Gmelin (1748 bis 1804) ist der Meinung, Chrysoberyll "hat eine spargelgrüne Farbe, oft ein Farbenspiel zwischen Meergrün oder Blaugrün und Goldgelb".
Ebenfalls möglich unter allen Chrysoberyll-Farben sind goldbraune, grünblaue, braune oder graue bis schwarze Exemplare, deren Farbe ursächlich mit Beimengungen von Eisen und Chrom begründet wird.
Bedingt durch die Farbe liegt deshalb vor allem die Verwechslung mit Zirkon, Spinell, Korund, Goldberyll, Peridot/Olivin, Apatit, Turmalin, Topas, Hiddenit/Spodumen oder Andalusit sowie Imitationen aus Zirkonia, Glas oder Hydroquarz nahe.
Dahingegen ist die Farbe von Cymophan ein milchig-trübes helles Graugrün bis Hellblau. Ein weiteres Merkmal, das Cymophan von Chrysoberyll unterscheidet ist die Chatoyance - der Katzenaugeneffekt bzw. ein schlitzartiger Lichtschein auf der Oberfläche des Minerals, oder wie Max Bauer (Mineraloge; 1844 bis 1917) schreibt: Cymophan ist von "grünlichweisser, selten goldgelber Farbe" mit einem "wogenden Lichtschimmer, der sich beim Drehen des Steines über dessen Oberfläche hinwegbewegt".
Die Strichfarbe von Chrysoberyll – die Farbe, die erscheint, wenn ein Mineral über ein unglasiertes Porzellantäfelchen gestrichen wird – ist weiß.
Entstehung und Verbreitung von Chrysoberyll
Chrysoberyll kann sowohl magmatischen als auch metamorphen Ursprungs sein. Magmatischer Chrysoberyll wird im Zusammenhang mit Pegmatiten – besonders grobkörnigen Magmatiten, gebildet. Beryllium-Atome sind vergleichsweise groß und können nicht gleich zu Beginn aus magmatischen Schmelzen auskristallisieren; reichern sich deshalb in Restschmelzen an, die wiederum zu einem späteren Zeitpunkt Kristalle, teilweise von erheblicher Größe, bilden.
Chrysoberyll, der in metamorphen Gesteinen entsteht, ist das Ergebnis der Reaktion von Gesteinen mit aufsteigenden aluminium- und berylliumhaltigen Fluiden.
Entsprechend ist Chrysoberyll in Graniten, Gneisen, Schiefern – häufig in Glimmerschiefer, und Marmoren zu finden.
Begleitet werden die Chrysoberyll-Vorkommen von Fluorit, Phenakit, Turmalin, Albit, Quarz, Topas, Muskovit, Apatit, Staurolith, Kyanit/Disthen und Phenakit.
Bedeutende Vorkommen von Chrysoberyll befinden sich bspw. in Schweden; England; Frankreich; Tschechien; Schweiz; Österreich; Italien; Russland; Madagaskar; Myanmar; China; Australien; Brasilien und in den USA.
Verwendung und Bedeutung von Chrysoberyll
Der Seltenheit und der Kristalle wegen ist Chrysoberyll ein geschätztes Mineral in Sammlungen, ist aber auch als Farbedelstein für Schmuck von Bedeutung.
Vor allem klare Kristalle von goldgrüner Farbe gelten als Steine von hohem Wert, deren Qualität mit Facettenschliffen am besten zur Wirkung kommt. Im 19. Jahrhundert war Chrysoberyll von "hohem Rang unter den Edelsteine", was vor allem der Farbe und dem Glanzes des Steins zu verdanken ist, wobei Chrysoberyll durch die Politur deutlich an Brillanz gewinnt, auch wenn er dem Chemiker Johann Baptist Riederer (1805 bis 1871) "sehr schwierig zu bearbeiten" ist. Doch die Arbeit am Stein ist es alle Mal wert, da Chrysoberyll im "Kerzenlicht für Diamant gehalten" wird.
Um die Leuchtkraft und Intensität der Farbe zu verstärken, wurde geschliffenem Chrysoberyll oftmals Goldfolie untergelegt - die nicht auffiel, da die Fassungen diese gekonnt versteckten (Seubert, 1883).
Des Weiteren wird Chrysoberyll als Heilstein verkauft, ohne dass eine Wirkung von Chrysoberyll auf die Gesundheit in wissenschaftlichen Untersuchungen bestätigt werden konnte. Hinweise auf die Verwendung oder Behandlung von Krankheiten mit Chrysoberyll finden sich weder in historischen Medizinbüchern noch in der aktuellen Literatur.
Nachweis von Chrysoberyll
Chrysoberyll ist nicht in Säuren löslich, fluoresziert nicht. Eine Ausnahme stellt grüner Chrysoberyll dar, der dunkelrot aufleuchtet. Der Pleochroismus erscheint in rotgelb, gelb bis grün.
© www.steine-und-minerale.de | Alle Inhalte - Texte und Bilder - sind urheberrechtlich geschützt. Keine Verwendung ohne vorherige schriftliche Genehmigung.
Auch interessant:
- Farbedelsteine und die Bewertung der Qualität von farbigen Edelsteinen
- Grüne Diamanten - Wenn radioaktive Strahlung Diamanten grün färbt
- Gefälschte Edelsteine und Mineralien
Quellen:
⇒ Gmelin, J. F. (1790): Chrysoberyll. IN: Grundriß der Mineralogie
⇒ Haüy, R. J. (1804): Lehrbuch der Mineralogie. 2. Theil
⇒ Riederer, J. B. (1859): Der Chrysoberyll. IN: Anleitung zur Kenntniß der Edelsteine
⇒ Zippe, F. X. M. (1859): Lehrbuch der Mineralogie mit naturhistorischer Grundlage
⇒ Köhler, A. W. (Hrsg., 1789): Bergmännisches Journal. Zweyter Jahrgang. Erster Band
⇒ Agricola, G. (1546): De Natura fossilium
⇒ Blumenbach, J. F. (1814): Handbuch der Naturgeschichte
⇒ Rose, G. (1842): Mineralogisch-geognostische Reise nach dem Ural, dem Altai und dem Kaspischen Meere. Zweiter Band
⇒ Seubert, K. (1883): Der Chrysoberyll. IN: Handbuch der Allgemeinen Warenkunde für das Selbststudium wie für den öffentlichen Unterricht von Karl Seubert und Moritz Seubert
⇒ Doelter y Cisterich, C. A. (1893): Chrysoberyll. IN: Edelsteinkunde. Bestimmung und Unterscheidung der Edelsteine und Schmucksteine. Die künstliche Darstellung der Edelsteine
⇒ Bauer, M. (1896): Chrysoberyll. IN: Edelsteinkunde. Eine allgemein verständliche Darstellung der Eigenschaften, des Vorkommens und der Verwendung der Edelsteine, nebst einer Anleitung zur Bestimmung derselben für Mineralogen, Steinschleifer, Juweliere, etc · Band 1
⇒ Pellant, C. (1994): Steine und Minerale. Ravensburger Naturführer. Ravensburger Buchverlag Otto Maier GmbH
⇒ Bauer, J.; Tvrz, F. (1993): Der Kosmos-Mineralienführer. Mineralien Gesteine Edelsteine. Ein Bestimmungsbuch mit 576 Farbfotos. Gondrom Verlag GmbH Bindlach
⇒ Korbel, P.; Novak, M. und W. Horwath (2002): Mineralien Enzyklopädie, Dörfler Verlag
⇒ www.mindat.org - Chrysoberyl