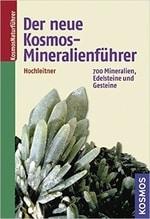Phlogopit
Phlogopit - Eigenschaften, Entstehung und Verwendung
englisch: phlogopite | französisch: phlogopite
Phlogopit - Ein Glimmermineral
Namensgeber des Minerals Phlogopit ist August Breithaupt (1791 bis 1873) – ein deutscher Mineraloge, auf den die Erstbeschreibung von Phlogopit im Jahr 1841 zurückgeht.
Unter dem Titel "Genus Phengites" geht er detailliert auf die "Species 1. Phengites Phlogopites" ein und begründet dabei den auf dem Griechischen stammenden Namen, der mit feurig übersetzt wird und in "Beziehung auf die äussere Farbe, aber auch auf die Färbung der Lötrohrflamme " zurückzuführen ist.
Eigenschaften von Phlogopit
Mit der chemischen Zusammensetzung KMg3(OH,F)2(AlSi3O10] wird Phlogopit der Systematik der Minerale zufolge den Silikaten zugeordnet. Innerhalb der Silikatminerale ist Phlogopit ein Vertreter der Glimmergruppe, speziell der dunklen, eisen- oder/und magnesiumreichen Glimmern.
Neben Biotit werden auch Zinnwaldit und Lepidolith zu den Dunkelglimmern gezählt.
Die Farbe von Phlogopit ist verglichen mit hellen Glimmermineralen wie Muskovit und Serizit dunkel. Typische Farben von Phlogopit sind grünbraun, rotbraun, braun oder gelbbraun – ähnlich wie Bernstein. Phlogopit kann aber auch farblos sein.
Die Strichfarbe ist dennoch in allen Fällen weiß.
Phlogopit kristallisiert im monoklinen Kristallsystem und bildet prismatische, pseudohexagonale (sechseckige) Kristalle, angeordnet zu schuppigen, plattigen bis massigen Aggregaten.
Der Glanz von Phlogopit ist perlmuttartig bis metallisch bei durchsichtiger bis durchscheinender Transparenz. Der Bruch ist uneben, die Spaltbarkeit ist sehr vollkommen – einzelne "Täfelchen" lassen sich mühelos voneinander trennen und weisen dabei eine elastische, biegsame Tenazität auf (Kristalle lassen sich verbiegen und springen anschließend ohne zu zerbrechen in die ursprüngliche Form zurück).
Phlogopit ist mit einer Mohshärte von 2 bis 2,5 ein weiches Mineral, dessen Dichte 2,75 bis 3 g/cm³ beträgt.
Entstehung und Verbreitung von Phlogopit
Phlogopit entsteht sowohl unter magmatischen wie auch metamorphen (Kontaktmetamorphose und Kontaktmetasomatose) Bedingungen und ist deshalb mineralischer Bestandteil zahlreicher Gesteine entsprechenden Ursprungs wie Kimberlit, Pikrit, Peridotit, Lamproit, Marmor, Granulit, Glimmerschiefer, Pyroxenit oder Serpentinit.
Zu den häufigsten Begleitmineralen von Phlogopit zählen weitere Glimmer wie Biotit und Muskovit. Phlogopit kann aber auch in Gegenwart von Lasurit, Enstatit/Pyroxene, Olivin, Epidot, Serendibit, Magnetit, Sapphirin, Dolomit, Augit, Diopsid, Afghanit, Apatit und Anthophyllit vorkommen.
Erwähnenswerte Vorkommen von Phlogopit befinden sich zum Beispiel in Grönland; Skandinavien; britische Inseln; Erzgebirge, Eifel, Kaiserstuhl und Hegau/Deutschland; Tessin und Binntal/Schweiz; Kärnten und Koralpe/Österreich; Spanien; Italien; Polen; Tschechien; Slowakei; Rumänien; Griechenland; Türkei; südliche Staaten Afrikas; Russland; Afghanistan; Indien; China; Japan; Philippinen; Australien; Neuseeland; Chile; Brasilien; Argentinien; Peru; Kanada und in den USA.
Verwendung und Bedeutung von Phlogopit
Phlogopit ist insbesondere von wirtschaftlicher Bedeutung, insofern das Glimmermineral in elektrischen Isolatoren eingesetzt wird.
Nachweis von Phlogopit
Phlogopit wird in konzentrierter Schwefelsäure gelöst, während verdünnte Salzsäure das Mineral nicht aufzulösen vermag. Zudem weist Phlogopit einen farblosen, gelbbraunen bis braunen Pleochroismus auf.
© www.steine-und-minerale.de | Alle Inhalte - Texte und Bilder - sind urheberrechtlich geschützt. Keine Verwendung ohne vorherige schriftliche Genehmigung.
Auch interessant:
- Hermanova-Kugeln - Glimmerkugeln aus Tschechien
- Mica, Glimmer und Kosmetik
- "Feldspat, Quarz und Glimmer - die drei vergess´ ich nimmer!
Quellen:
- Breithaupt, A. (1841): Genus Phengites. Species 1. Phengites Phlogopites. IN: Vollständiges Handbuch der Mineralogie
- Kenngott, G. A. (1854): Phlogopit. IN: Uebersicht der Resultate mineralogischer Forschungen im Jahre 1854
- Hartmann, C. F. A. (1859): Handwörterbuch der Berg-, Hütten- u. Salzwerkskunde, der Mineralogie und Geognosie
- Bauer, J.; Tvrz, F. (1993): Der Kosmos-Mineralienführer. Mineralien Gesteine Edelsteine. Ein Bestimmungsbuch mit 576 Farbfotos. Gondrom Verlag GmbH Bindlach
- Pellant, C. (1994): Steine und Minerale. Ravensburger Naturführer. Ravensburger Buchverlag Otto Maier GmbH
- Steinbach, G. (1996): Steinbachs Naturführer Mineralien. 223 Artbeschreibungen, 362 Farbfotos, 250 Zeichnungen und 30 Seiten Bestimmungstabellen. Mosaik Verlag München
- Korbel, P.; Novak, M. und W. Horwath (2002): Mineralien Enzyklopädie, Dörfler Verlag
- Okrusch, M. und S. Matthes (2009): Mineralogie: Eine Einführung in die spezielle Mineralogie, Petrologie und Lagerstättenkunde. Springer Verlag Berlin Heidelberg
- www.mindat.org - phlogopite