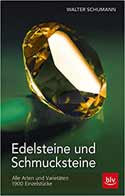Rochlitzer Porphyr – Rochlitzer Marmor
Die Stadt Rochlitz in Mittelsachsen – etwa 60 km südöstlich von Leipzig entfernt – wurde über die Stadtgrenzen hinaus aufgrund eines Gesteins bekannt, das in zahlreichen Bauwerken verwendet wurde: rhyolithischer Tuff, der im Zusammenhang mit Rochlitz auch als Rochlitzer Porphyr oder Rochlitzer Marmor bezeichnet wird. Ein Gestein, das 2022 den Titel IUGS Heritage Stone erhielt: Das Quasipendant zum Weltkulturerbe der Geologie, gekürt von der International Union of Geological Scienes.
Porphyr, Rhyolith, Marmor und Tuff
Das Gestein von Rochlitz ist unter vielen Namen bekannt: Porphyr, Marmor, Rhyolith und Tuff.
Gesteine, die aus geologischer Sicht deutliche Unterschiede in puncto mineralische Zusammensetzung, Farbe und Entstehung aufweisen.
Unter der Bezeichnung Porphyr wird in Geologie ein Gesteinsgefüge verstanden, in dessen feinkörniger Gesteinsmatrix größere Kristalle oder Bruchstücke anderer Gesteine zu erkennen sind.
Das magmatische Gestein Rhyolith ist ein Vertreter der Gesteine mit porphyrischem Gefüge.
Marmor ist ein Gestein, das unter metamorphen Bedingungen entstanden bzw. das Ergebnis der Gesteinsumwandlung ist. Im Zuge der Regional- oder Kontaktmetamorphose wurden die Ausgangsgesteine von Marmor – Kalkstein oder Dolomit – infolge der Einwirkung von hohen Druck- und Temperaturbedingungen im Mineralbestand verändert. Einst vorhandene Mineralien wurden aufgeschmolzen und rekristallisierten als neue Mineralien. Das typische Merkmal von Marmor sind feiner Adern, Streifen oder Flecken, deren Farbe sich von der Grundfarbe des Gesteins abhebt.
Tuff ist ein Gestein magmatischen Ursprungs, das sich durch einen porenreichen Charakter auszeichnet und durch die Ablagerung von vulkanischem Material während zahlreicher Ausbrüche entstanden ist.

Rochlitzer Porphyr – Die Eigenschaften
Petrographisch betrachtet ist beim Rochlitzer Porphyr weder Porphyr bzw. Rhyolith oder Marmor, sondern Porphyrtuff.
Das Merkmal von Porphyrtuff ist ein feinkörniges Gesamtbild, in dem gröbere Mineralien oder Gesteinsfragmente eingebettet sind. Tatsächlich ist Porphyrtuff mit Porphyr „verwandt“, was den Mineralbestand betrifft, die Entstehung ist aber eine andere.
Die Farbe des Rochlitzer Porphyrs variiert zwischen rötlich, rotviolett, gelbgrau, hellbraun bis rotgrau. Der Mineraloge und Geologe Carl Friedrich Naumann (1797 bis 1873) unterschied einst zweierlei Farbschichten des Rochlitzer Porphyrs. Der untere Porphyr von Rochlitz ist "licht-fleischroth, röthlich-grau bis röthlich-weiß, auch grünlich-weiß bis schmutzig-berggrün, zuweilen licht-gelblich-braun oder lavendelblau", wobei die Farbe auch miteinander vermischt, "fleckig, erdig und wolkig" erscheinen können. Der obere Rochlitzer Porphyr hingegen ist "lavendelblau bis fast violblau und bräunlich-roth", teilweise auch "perlgrau, fleisch- bis ziegelroth"
In allen Fällen ist die Färbung des Gesteins Ausdruck der gesteinsbildenden Mineralien.
Namentlich handelt es sich zum Großteil um Feldspäte, Glimmer, Quarz, Pyroxene und Amphibole, die den Großteil der mineralischen Zusammensetzung bestimmen. Unter den Feldspäten hebt der Geowissenschaftler Hermann Credner (1841 bis 1913) im Besonderen die "wasserhellen, stark glänzenden Orthoklase"hervor.
Im Gegensatz zu „echtem“ Porphyr bzw. Rhyolith ist der Rochlitzer Porphyrtuff von zahlreichen Hohlräumen durchsetzt, die mit gröberen Quarz- und Feldspatkristalle oder anderen Gesteinsfragmenten verfüllt sind. Ein weiteres Merkmal des Rochlitzer Porphyrs ist die vergleichsweise hohe Porosität; Credner spricht von "langgezogenen, einander parallelen Blasenräumen, die so flach zusammengedrückt sind, dass sie leicht übersehen werden können". Naumann beobachtete, dass die Größe der Hohlräume zwischen einem halben bis vier Zoll, 0,5 cm bis 10 cm, entspricht. Porphyr ist ein kompaktes, massiges Gestein. Das Gestein aus Rochlitz weist eine Porosität von 30 Vol% auf, gilt dennoch als witterungsbeständig.
Dass Porphyrtuff immer noch als Porphyr vertrieben wird, ist historisch bedingt. In der Vergangenheit wurde das Gestein aufgrund des Aussehens und der Zusammensetzung als Porphyr bezeichnet. Mit dem Wissenszuwachs der Geologie konnten Unterschiede in Hinblick auf die Entstehung ausgemacht werden.
Neben dem Namen Rochlitzer Porphyr hat sich ein weiterer Begriff für die hiesigen Gestein etabliert: Rochlitzer Marmor. Die Bezeichnung und der Vergleich liegt nah: feine, marmorähnliche Zeichnungen durchziehen das Gestein, dass eine Verwechslung mit dem metamorphen Gestein Marmor möglich ist.
Der Rochlitzer Berg
Das Abbaugebiet des Rochlitzer Porphyrs befindet sich in der näheren Umgebung des Rochlitzer Berges.
Seit mehr als 1000 Jahren wird am Rochlitzer Berg Porphyrtuff abgebaut und als Werk- und Naturstein für Fassaden, Bodenbeläge, Fensterrahmen, Säule, Dekore und als Bildhauerstein verwendet. Naumann zufolge ist es allerdings vorrangig der obere Rochlitzer Porphyr, der als "Werkstein" verwendet wird und begründet das mit der "geringen Sprödigkeit und mittleren Härte des Gesteins". Die Schichten unterhalb des unteren Rochlitzer Porphyrs wären weniger gut als Werkstein geeignet. Naumann nennt diese "faule Schichten", die "morsch und weich" wären
Der Rochlitzer Berg ist ein 348,9 m hohes Zeugnis des Vulkanismus´, der im Rotliegenden vor 305 bis 255 Mio. Jahren die Region beherrschte. Immer wieder wurde kieselsäurereiche Magma eruptiert, Pyroklastika und Asche lagenweise sedimentiert und im Laufe der Zeit zu porösem Rhyolithtuff verfestigt. Naumann erkannte seinerzeit einen "Parallelismus der Lage", den er vor allem anhand der in die Länge gestreckten Blasenhohlräume ausmachte. Die Zementation der Lockermaterialien erfolgte durch immer wiederkehrendes, glutheißes und neues Material infolge der Vulkanausbrüche, das auf ältere Schichten traf und die Lockermaterialien förmlich miteinander verbacken wurden. Insgesamt erfasst die vulkanische Vergangenheit des Rochlitzer Berges eine Fläche von 2000 km² und bildete eine Mächtigkeit der Porphyrtuffe von ca. 400 m.
Rochlitz gilt als die „Stadt des roten Porphyrs“, doch das Gestein wurde nicht nur in Rochlitz verbaut, wie bspw. In der Kunigundenkirche, am Friedrich-August-Turm – dem Wahrzeichen des Rochlitzer Berges, in der Muldentalbrücke von Rochlitz oder im Schloss Rochlitz. Rochlitzer Porphyr findet sich unter anderem auch im Alten Rathaus Leipzig, in der Fundamentplatte vom Brandenburger Tor, in der Burg Eilenburg, im Schloss Glauchau und in der St. Nikolai-Kirche in Döbeln wieder.
Bedingt durch die Tatsache, dass die Vorkommen endlich sind und in der Vergangenheit etliche Kubikmeter Gestein abgebaut wurden, sind mittlerweile große Bereiche des Rochlitzer Berges unter Naturschutz gestellt. Die Menge der abbaubaren Ressourcen ist limitiert.
Auch interessant:
- Der Amethyst von Geyer (Sachsen)
- Die Schneekopfkugeln vom Thüringer Wald
- Sächsische Diamanten oder Der Topas vom Schneckenstein
Quellen:
- Naumann, C. F. (1836): Erläuterungen zu der geognostischen Charte des Königreiches Sachsen und der angränzenden Länderabtheilungen. Erläuterungen zu Section XIV der geognostischen Charte des Königreiches Sachsen und der angränzenden Länderabtheilungen, oder Geognostische Skizze der Gegend zwischen Taucha, Strehla, Bräunsdorf und Altenburg
- Leonhard, G. v. (1851): Rochlitzer Porphyr. IN: Die Quarz- führenden Porphyre nach ihrem Wesen, ihrer Verbreitung, ihrem Verhalten zu abnormen und normalen Gesteinen, so wie zu Erzgängen
- Credner, H. (1880): Geologischer Führer durch das sächsische Granulitgebirge
- Maresch, W., Medenbach, O.; Trochim, H.-D. (1987): Die farbigen Naturführer Gesteine. Mosaik Verlag GmbH München
- Murawski, H. (1992): Geologisches Wörterbuch. Ferdinand Enke Verlag Stuttgart
- Bauer, J.; Tvrz, F. (1993): Der Kosmos-Mineralienführer. Mineralien Gesteine Edelsteine. Ein Bestimmungsbuch mit 576 Farbfotos. Gondrom Verlag GmbH Bindlach
- Wagenbreth, O. und W. Steiner (2001): Geologische Streifzüge. Landschaft und Erdgeschichte zwischen Kap Arkona und Fichtelberg. Spektrum Akademischer Verlag
- Okrusch, M. und S. Matthes (2009): Mineralogie: Eine Einführung in die spezielle Mineralogie, Petrologie und Lagerstättenkunde. Springer Verlag Berlin Heidelberg
- www.porphyr-rochlitz.de
- www.pophryland,de - Auf den Spuren des Rochlitzer Porphyrs; Der Porphyrlehrpfad von Rochlitz
Letzte Aktualisierung: 10. April 2024