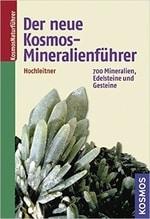Klinoptilolith
Klinoptilolith - Eigenschaften, Entstehung und Verwendung
englisch: clinoptilolite

Klinoptilolith - Ein Zeolith-Mineral
Der Name Klinoptilolith ist griechischen Ursprungs und wird mit geneigter Federstein übersetzt.
Der von Waldemar Theodore Schaller (1882 bis 1967, Mineraloge aus den USA) geprägte Name bezieht sich namentlich sowohl auf die geneigte optische Achse, die den Lichteinfall im Mineral abschwächt als auch die Ähnlichkeit der chemischen Zusammensetzung zum Silikatmineral Mordenit – ein Zeolith, auch Ptilolith genannt.
Die Typlokalität von Klinoptilolith befindet sich am Hoodoo Moutain in Wyoming/USA.
Eigenschaften von Klinoptilolith
Klinoptilolith, bestehend aus (Na,K,Ca)2-3Al3(AlSi)2Si13O36 · 12H2O, wird der Mineralklasse der kristallwasserhaltigen Silikate, ferner den Zeolithen, zugeordnet. Angelehnt an das im Klinoptilolith vorherrschende Element Natrium, Kalium oder Calcium wird das Zeolithgruppenmineral in Klinoptilolith-Na, Klinoptilolith-K und Klinoptilolith-Ca unterschieden.
Die Farbe von Klinoptilolith variiert zwischen farblos, weiß, in abgeschwächter Form auch grün, rot oder gelb.
Die Strichfarbe des Vulkanminerals Klinoptolith ist weiß.
Klinoptilolith kristallisiert nach dem monoklinen Kristallsystem. Gut ausgebildete Kristalle existieren nur bei geringer Größe des Minerals, häufiger sind plattige bis derbe Formen.
Der Glanz von Klinoptilolith glasartig, die Transparenz ist durchsichtig bis durchscheinend. Die Spaltbarkeit des Zeolith-Vertreters ist vollkommen, der Bruch muschelig bis uneben.
Die Mohshärte beträgt 3,5 bis 4 bei einer Dichte von 2,1 bis 2,2 g/cm³.
Entstehung und Verbreitung von Klinoptilolith
Klinoptilolith ist Mineral sedimentären Ursprungs, das aus Ablagerungen vulkanischer Herkunft wie Tuffen und Vulkangläsern hervorgeht.
Daneben kann Klinoptilolith auch in Hohlräumen diverser magmatischer Gesteine wie Andesit, Basalt oder Rhyolith enthalten sein. Begleitende Minerale von Klinoptilolith sind weitere Zeolithe, Halit, Quarz, Calcit, Opal, Montmorillonit, Hectorit, Gaylussit, Thenardit und Seladonit.
Wirtschaftlich ertragreiche Klinoptilolith-Vorkommen befinden sich z.B. in Cornwall/England; Vogelsberg, Franken/Deutschland; Steiermark/Österreich; Andalusien/Spanien; Ionische Inseln/Griechenland; Ostküste Türkei; Honshu/Japan; südliches Neuseeland; Chubut/Argentinien; South Dakota, Wyoming sowie die Westküste der USA und Nova Scotia, Quebec, British Columbia/Kanada.
Verwendung und Bedeutung von Klinoptilolith
Die Einsatzmöglichkeiten von Klinoptilolith sind vielseitig.
In der Landwirtschaft wird Klinoptilolith in Stallungen zur Bindung von ammoniakhaltigen Gerüchen, als Dünger oder als Zuschlagstoff in Futtermitteln von Nutztieren verwendet. In Studien mit Schafen und Kühen konnte nachgewiesen werden, dass Klinoptilolith über die Nahrung aufgenommen, Schwermetallbelastungen und Krankheitskeime binden kann, die anschließend über Stoffwechselendprodukte ausgeschieden werden (siehe "Zeolithe - Minerale im Einsatz gegen Radioaktivität").
Weiterhin wird Klinoptilolith in handelsüblichen Lufterfrischern, als Wasserenthärter und Pflanzsubstrat beispielsweise für Kakteen verwendet.
Daneben wird Klinoptilolith als Nährungsergänzungsmittel angeboten.
Bekanntheit erlangte Klinoptilolith auch im Zusammenhang mit radioaktiven Kontaminationen. So wurde das Mineral bereits nach den Atombombenabwürfen von Hiroshima und Nagasaki, dem Unglück von Tschernobyl, auf Kernwaffentestgeländen und auch zuletzt, wenn auch verspätet, in Fukushima/Japan eingesetzt, um radioaktive Substanzen per Kationenaustausch zu binden und an einer Verlagerung zu hindern.
Nachweis von Klinoptilolith
Klinoptilolith gibt beim Erhitzen einen kontinuierlichen Wasserstrom frei, zudem fluoresziert Klinoptilolith hellgrün.
Auch interessant:
- Heilsteine - Steine mit Wirkung auf die Gesundheit?
- Mineralische Kakteenerde
- Zeolithe im Waschmittel
Quellen:
⇒ Schaller, W.T. (1932): The mordenite-ptilolite group; clinoptilolite, a new species. IN: American Mineralogist
⇒ Korbel, P.; Novak, M. und W. Horwath (2002): Mineralien Enzyklopädie, Dörfler Verlag
⇒ Strunz, H., Nickel, E. H. (2001): Strunz Mineralogical Tables. Chemical-structural Mineral Classification System. 9. Auflage.
⇒ www.mindat.org
⇒ www.handbookofmineralogy.org