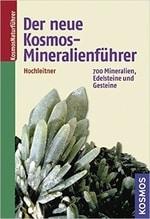Gips
Gips - Eigenschaften, Entstehung und Verwendung
englisch: gypsum | französisch: gypse

Gips - Ein wasserhaltiges Sulfatmineral
Der Name Gips wird bereits seit der Antike verwendet. Wie der Mineraloge Karl Cäsar von Leonhard (1779 bis 1862) im Jahr 1821 schreibt, ist der Name Gips griechischen Ursprungs und stammt "von gypsos, welches in der Bedeutung Kreide bei Herodotus VII 69. vorkommt", führt dann weiter an, dass Plinius (23 bis 79 n.Chr.) und Theophrast (371 bis 278 v.Chr.) als Autoren naturwissenschaftlicher Schriften den Begriff Gips als erste verwendeten.
Über den Grund, weshalb die antiken Gelehrten Gips mit Kreide verglichen, kann nur spekuliert werden. Möglicherweise sind es die Calciumgehalte des Minerals oder die kreideartige Haptik von getrocknetem Gips.
In älteren Mineralogiebüchern, ca. bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wird Gips teilweise unter der lateinischen Form Gyps, gypseum spathum oder gypsum lamellare beschrieben, die Bezug auf die Ausbildung der Kristalle nehmen; genau wie der Begriff Gypsspath bzw. Gipsspat ein Hinweis auf die perfekt zerlegbaren Kristalle ist.

Eigenschaften von Gips
Definition: Gips ist ein kristallwasserhaltiges Mineral mit der chemischen Zusammensetzung CaSO4·2H2O/Calciumsulfat-Dihydrat, oder wie es 1847 bei Friedrich Hausmann 1782 bis 1859; Mineraloge und Geologe) heißt: "schwefelsauer Kalke (...) in seinem wasserhaltigen Zustande", das der der Mineralklasse der Sulfate zugeordnet wird.
Die Farbe von Gips kann farblos, weiß, rötlich, bräunlich, gelblich, grau, blau oder schwarz sein - abhängig von den in den Kristallen enthaltenen, farbgebenden "Verunreinigungen", oder wie von Leonhard 1824 schreibt, ist "Gypsspath vollkommen rein und stets wasserhell oder weiß, auch röthlich, oder, durch Beimengungen von Bitumen, rauchgrau und braunlichschwarz".
Außerdem beobachtete der Mineraloge, dass Gips keineswegs nur einfarbig und von homogener Farbe ist. Tone, Bitumen, Eisenoxide oder Mergel führen dazu, dass Gips streifig bis fleckig ist oder einen Farbwechsel aufweist.
Die Strichfarbe des wasserhaltigen Calciumsulfats ist weiß;. d.h., wird Gips über ein unglasiertes Porzellantäfelchen gestrichen, entsteht ein weißer, pulverisierter Abrieb.
Gips kristallisiert im monoklinen Kristallsystem mit prismatischen, flachen Kristallen. Die Aggregate von Gips bilden unterschiedliche Erscheinungsformen
- faserig: Fasergips
- tafelig: Marienglas/Fraueneis
- körnig: Alabaster/veraltet: Schlottengips
- derb oder als
- Rosetten angeordnet (Wüstenrose)
ausgeprägt sein. Zwillingsbildungen sind bei Gipskristallen häufig.
Mitunter zeigen die Kristalle Wölbungen auf, so dass die Verwachsungen an Schwalbenschwänze erinnern (sog. Schwalbenzwillinge).
Der Glanz von Gips ist glasartig bis seidig, auf Spaltflächen auch perlmuttartig. Die Transparenz des Minerals ist durchsichtig bis undurchsichtig. Gips weist einen faserig-muscheligen Bruch und eine vollkommene Spaltbarkeit auf.
Gips ist ein sehr weiches Mineral, dessen Kristalle sich einfach mit den Fingern zerlegen bzw. abtrennen lassen. Auf der 10-stufigen Skala der Härte von Mineralien nach dem Mineralogen Friedrich Mohs (1773 bis 1839) beträgt die Mohshärte von Gips 1,5 bis 2. Die Dichte beträgt 2,2 bis 2,4 g/cm3.

Gips, Marienglas und Selenit
Marienglas und Selenit sind neben Alabaster häufig vorkommende Varietäten von Gips, wie bereits 1777 der schwedische Naturforscher Carl von Linné (1707 bis 1778) erkannte.
Der Name Marienglas als Varietät von Selenit hat sich für tafelartige, fensterähnliche Kristalle, die von besonders hoher Reinheit sind, das der Vergleich mit Fensterglas aufkommt, etabliert.
In der Vergangenheit wurde Marienglas als Glasersatz in der Darstellung von Ikonen, insbesondere Maria und Jesus, verwendet.
Entstehung und Verbreitung von Gips
Gips kann auf zweierlei Weise entstehen, wie Friedrich August Quenstedt (1808 bis 1889, Geologe) 1855 feststellte: "auf trockenem als nassem Wege statt".
Auf dem "nassen Weg" geht Gips als Evaporationsprodukt aus der Eindunstung calciumsulfathaltiger Lösungen hervor.
Alternativ kann Gips entstehen, indem wasserfreier Anhydrit mit Wasser versetzt wird.
Anhydrit ist chemisch betrachtet ebenfalls Calciumsulfat. Der einzige Unterschied zwischen Gips und Anhydrit ist das fehlende Kristallwasser im Anhydrit, das durch Wasserzugabe in das Kristallgitter eingeschlossen werden kann - in der Folge entsteht aus Anhydrit Gips.
Gips als Resultat der Entstehung auf "trockenem Weg" steht im Zusammenhang mit der Verwitterung von schwefelhaltigen Mineralien in unterirdischen Erzgängen.
Nicht zuletzt entsteht Gips unter dem Einfluss von Vulkanismus, wenn Schwefelwasserstoff oder Schwefelsäure auf Kalkstein trifft und diesen chemisch verändert - mit dem Ergebnis, dass Gips entsteht:
Reaktionsgleichung: H2SO4 + CaCO3 → CaSO4 + H2O + CO2.
Die Vorkommen von Gips sind mit einer Reihe weiterer Minerale vergesellschaftet, darunter u.a. Anhydrit, Brucit, Calcit, Clarait, Halit, Eisenblüte/Flos ferri, Zinkblende, Galenit, Pyrit, Coelestin, Aragonit, Schwefel und Chambersit vorkommen.
Erwähnenswerte Fundorte von Gips befinden sich in England; Frankreich; Rüdersdorf bei Berlin (Brandenburg); Mansfelder Land (Staßfurt, Eisleben), Kyffhäusergebirge (Barbarossahöhle), Harz, Marienglashöhle in Friedrichroda (Thüringen), Schwäbische Alb, Kassel, Berchtesgaden (Bayern)/Deutschland; Tirol, Steiermark, Kärnten/Österreich; Polen; Toskana/Italien; Laurion/Griechenland; Russland; Spanien; Iran; Algerien; Chile; Mexiko; New York, Utah, Kansas, Dakota, Michigan/USA.

Synthetische Gewinnung von Gips
Heutzutage gewinnt man Gips nur noch vereinzelt durch den Abbau in Bergwerken. Das liegt weniger an der verfügbaren Menge des Industrieminerals. Vielmehr entsteht Gips als Nebenprodukt der Herstellung von Weinsäure, Oxalsäure und Zitronensäure.
Bedeutung und Verwendung von Gips
Gips wird vielseitig verwendet und deshalb vom Bundesverband der Deutschen Geowissenschaftler zum Gestein des Jahres 2022 gekürt.
In der Medizin dient das Mineral als Material für Gipsumschläge, in der Papierindustrie als Zuschlagstoff für die Herstellung selbigen und in der Bauindustrie werden aus Gips Estrich-und Stuckgips, Kitt oder Gipskartonplatten (Rigips) gefertigt.
Dass Gips derart vielseitig verwendet werden kann, erkannte schon 1892 Friedrich Klockmann (1858 bis 1937). Der Mineraloge begründet die Verwendung von Gips - vor allem interessant als Hintergrundwissen bezüglich der Verwendung als Gipsverband, für Herstellung von Gipsfiguren oder Stuck - mit dem Verhalten bei Hitzezufuhr und dem Umstand bei "über 100° drei Viertel seines Wassergehaltes zu verlieren, der dann von dem Pulver bei Wasserzusatz schnell und unter Erstarren wieder aufgenommen wird".
Nachweis von Gips
Bei Erhitzung auf Temperaturen oberhalb von 163 °C wird das im Gips enthaltene Kristallwasser freigesetzt. Die Löslichkeit von Gips ist sowohl in erwärmter Salzsäure als auch erwärmtem Wasser gegeben.
Auch interessant:
- Steter Tropfen höhlt den Stein - Ein Spricht aus Sicht der Geologie
- Mineralwasser - Ein Fingerabdruck des geologischen Untergrunds
- Tafelkreide - Nicht Kreide, sondern Gips
Quellen:
- Baumer, J. W. (1763): Von den gypsartigen Steinen. IN: Naturgeschichte des Mineralreichs mit besonderer Anwendung auf Thüringen. Band 1
- Linné, C. v. (1777): Natursystem des Mineralreichs
- Gmelin, J. F. (1790): Gips. IN: Grundriß der Mineralogie
- Leonhard, K. C: (1821): Handbuch der Oryktognosie für akademische Vorlesungen und zum Selbststudium
- Leonhard, K. C: (1823): Charakteristik der Felsarten
- Hausmann, J. F. L. (1847): Bemerkungen über Gyps und Karstenit
- Quenstedt, F. A: (1855): Handbuch der Mineralogie
- Klockmann, F. (1892): Lehrbuch der Mineralogie für Studirende und zum Selbstunterricht
- Schumann, W. (1991): Mineralien Gesteine – Merkmale, Vorkommen und Verwendung. BLV Naturführer. BLV Verlagsgesellschaft mbH München
- Bauer, J.; Tvrz, F. (1993): Der Kosmos-Mineralienführer. Mineralien Gesteine Edelsteine. Ein Bestimmungsbuch mit 576 Farbfotos. Gondrom Verlag GmbH Bindlach
- Pellant, C. (1994): Steine und Minerale. Ravensburger Naturführer. Ravensburger Buchverlag Otto Maier GmbH
- Medenbach, O.; Sussieck-Fornefeld, C.; Steinbach, G. (1996): Steinbachs Naturführer Mineralien. 223 Artbeschreibungen, 362 Farbfotos, 250 Zeichnungen und 30 Seiten Bestimmungstabellen. Mosaik Verlag München
- Okrusch, M. und Matthes, S. (2014): Mineralogie. Eine Einführung in die spezielle Mineralogie, Petrologie und Lagerstättenkunde
- www.mindat.org - Gypsum