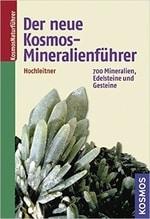Galenit
Galenit - Eigenschaften, Entstehung und Verwendung
englisch: galena | französisch: gàlena

Galenit und Bleiglanz
Der Name Galenit wird vom Lateinischen galena abgeleitet, was mit Blei übersetzt wird und sich direkt auf die Zusammensetzung des Minerals bezieht.
Bereits zu Zeiten von Plinius dem Älteren (23 bis 75) war Galenit als Bleierz bekannt und stand vielmehr als Sammelbegriff für bleihaltige Mineralien bzw. metallische Sulfidmineralien, ohne ein konkretes Mineral zu definieren oder näher zu unterscheiden.
Erst als sich der deutsche Mineraloge und Geologe Abraham Gottlob Werner (1749 bis 1819) diesem Thema annahm, wurden fortan lediglich Bleierze, die aus Bleisulfid bestehen, als Galenit bezeichnet.
Eigenschaften von Galenit
Galenit ist mit der chemischen Zusammensetzung PbS ein Vertreter der Mineralklasse der Sulfide.
Die Farbe von Galenit ist metallisch-grau bis silbrig, d.h. typisch bleigrau, kann mit der Zeit aber auch blau anlaufen.
Die Strichfarbe von Galenit ist grauschwarz.
Galenit kristallisiert dem kubischen Kristallsystem folgend; typisch sind Würfel, Oktaeder und Tafeln. Zwillingsbildungen sind bei Galeniten rar. Die Aggregate des Minerals erscheinen klumpig, nierig, traubig, mikrokristallin oder faserig. Dichte Galenit-Aggregate wurden in der Vergangenheit unter dem Begriff "Bleischweif" geführt.
Galenit zeichnet sich durch einen muschelig-spröden Bruch aus und aufgrund der vollkommenen Spaltbarkeit lassen sich definierte Würfel absondern. Der Glanz von Galenit variiert zwischen stark metallisch und matt bei undurchsichtiger Transparenz.
Galenit ist mit einer Mohshärte von 2,5 bis 3 auf der 10-stufigen Skala nach dem Mineralogen Friedrich Mohs (1773 bis 1839) ein weiches Mineral, die Dichte beträgt auf 7,2 bis 7,6 g/cm³.

Entstehung und Verbreitung von Galenit
Galenit kann unter metamorphen wie auch magmatischen Verhältnissen entstehen, bevorzugt Sulfidlagerstätten, die hydrothermal überprägt wurden, wobei die Kristalle von Galenit auch in Adern, Gängen und Flözen in Sedimentgesteinen vorkommen.
Die Vorkommen von Galenit sind mit zahlreichen Mineralien vergesellschaftet, darunter u.a. Wulfenit, Markasit, Pyromorphit, Pyrargyrit, Zinnwaldit, Dyskrasit, Stannit, Zinkblende, Fluorit, Silber, Quarz, Chalkopyrit, Pyrit, Siderit, Dolomit, Cerussit, Baryt und Calcit.
Galenit zählt zu den weltweit häufig vorkommenden Mineralen. Beachtliche Funde sind unter anderem in Skandinavien; Schottland; England; Wales; Irland; Frankreich; im Erzgebirge, Nordhausen, Schnellbach, Gera, Goslar, Münsterland, Sauerland, Westerwald, Eifel, Hunsrück, Odenwald, Oberpfälzer Wald, Saarlouis, Schwarzwald/Deutschland; Wallis/Schweiz; Hohe Tauern, Kreuzbergl, Saualpe, Moschkogel, Tanzenberg/Österreich; Portugal; Spanien; Italien; Tschechien; Slowakei; in den Staaten auf der Balkanhalbinsel; Ukraine; Russland; im zentralen und südlichen Afrika; Saudi-Arabien; Tadschikistan; Afghanistan; Indien; Thailand; China; Japan; Malaysia; Papua-Neuguinea; Australien; Neuseeland; Süd-, Mittel- sowie Nordamerika möglich.
Verwendung und Bedeutung von Galenit
Galenit ist insbesondere für die Gewinnung von Blei bedeutend. Das Mineral besteht bis zu 86,6 % aus Blei, aber auch andere Metalle sind als Beimengung in Spuren in Galenit vorhanden. Mit einem Anteil von bis zu einem Prozent ist allen voran Silber zu nennen, gefolgt von Gold, Bismut, Selen, Kupfer, Arsen, Zink, Eisen, Zinn, Antimon und Cadmium, die Galenit wirtschaftlich interessant machen.
In der Vergangenheit wurde Galenit als Pigment in Schminke verwendet. So wurde im Alten Ägypten pulverisierter Galenit als grau-schwarzer Kajal zum Betonen der Augen genutzt. Erhitzt veränderte sich die bleigraue Galenitfarbe und wird rot, weshalb man das Mineral auch als Lippenstift und Rouge auftrug - vermutlich ohne zu wissen, dass Galenit giftig ist.
Nachweis von Galenit
Galenit ist in Salzsäure unter Entwicklung von Schwefelwasserstoff löslich. Unter Einwirkung von Sauerstoff reagiert Galenit mit selbigen und kann sich in die Minerale Pyromorphit, Anglesit oder Cerussit umwandeln. Im Elektroofen schmilzt Galenit bei 1114°C.
Galenit fluoresziert nicht.
Auch interessant:
- Erz - Metallhaltige Mineralien und Gesteine
- Schlacke - Nebenprodukt der Erzverhüttung
- Seltene Erden - Rohstoff für Zukunftstechnologien
Quellen:
- Suckow, G. A. (1790): Plumbum. IN: Anfangsgründe der Mineralogie
- Lenz, J. G. (1794): Plombo galenico. IN: Versuch einer vollständigen Anleitung zur Kenntniss der Mineralien. Metalle und Gebirgsarten
- Kenngott, A. (1862): Galenit. IN: Uebersicht der Resultate mineralogischer Forschungen in den Jahren 1844-1861
- Andrae, C. J. (1864): Bleiglanz (Bleischweif, Schwefelblei, Galenit). IN: Lehrbuch der gesammten Mineralogie
- Zepharovich, L. (1877): Galenit von Habach in Salzburg
- Bauer, M. (1886): Bleiglanz (Galenit). IN: Lehrbuch der Mineralogie
- Bauer, J.; Tvrz, F. (1993): Der Kosmos-Mineralienführer. Mineralien Gesteine Edelsteine. Ein Bestimmungsbuch mit 576 Farbfotos. Gondrom Verlag GmbH Bindlach
- Pellant, C. (1994): Steine und Minerale. Ravensburger Naturführer. Ravensburger Buchverlag Otto Maier GmbH ⇒ Korbel, P.; Novak, M. und W. Horwath (2002): Mineralien Enzyklopädie, Dörfler Verlag
- Okrusch, M. und Matthes, S. (2013): Mineralogie. Eine Einführung in die spezielle Mineralogie, Petrologie und Lagerstättenkunde
- www.mindat.org - galena